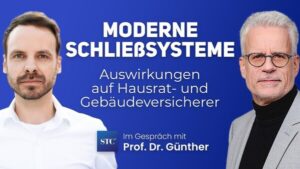Schreiben Sie uns Ihre Nachricht






Smart Home Systeme sind bereits auf dem Markt. Lebensmittel werden bei Bedarf vom Kühlschrank selbständig bestellt. Der Backofen lässt sich aus der Ferne mit dem Smartphone vorheizen. Das Kochfeld informiert, ob die Herdplatte noch an ist. Die Alarmanlage berichtet über offene Fenster, erfasst Bewegungen in der Wohnung und schickt Fotos und Videos dem Berechtigten. Durch diese technischen Innovationen entsteht für Gebäude- und Hausratversicherer die Herausforderung, sich durch Entwicklung neuer Tarifmodelle anzupassen und neue Probleme hinsichtlich der Durchführung von Versicherungsverträgen zu lösen.
Smart Home ist die Vernetzung verschiedenster Komponente im Hausrat, die im Rahmen einer Fernwartung abgerufen werden können. Obwohl Smart Home Systeme noch keine vollständige Vernetzung der Wohnung gewährleisten können, befindet sich die Technologie bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase. Die schnelle Veränderung auf dem Markt hat mit sich völlig unbekannte Umstände gebracht, deren Berücksichtigung im Rahmen eines adäquaten Versicherungsschutzes unerlässlich ist.
Das Smart Home erhält Versicherungsschutz nicht grundsätzlich von der Wohngebäudeversicherung. Vielmehr ist jedes einzelne künstlich intelligente Gerät nach den allgemeinen Kriterien der Hausrat- oder der Wohngebäudeversicherung zuzuordnen. Die Steuerungssoftware – das zentrale Element des vernetzten Zuhauses – wird allerdings weder von der Hausrat- noch von der Gebäudeversicherung geschützt. Beide Versicherungszweigen schließen den Schutz elektronisch gespeicherter Daten und Programme in den Versicherungsbedingungen aus. Allenfalls durch eine gesonderte Cyberversicherung lässt sich auch die Smart Home Software versichern.
Die Kommunikation zwischen mehreren künstlich intelligenten Endgeräten bietet Bewohnern größeren Komfort und mehr Sicherheit.
Mit zunehmender Vernetzung werden bestehende Risiken deutlich gemindert. Man denke etwa an einen Abschaltmechanismus, der in den meisten modernen Küchen- und Haushaltsgeräten mit eingebaut ist. Durch den Einsatz einer Monitoring Software kann etwa einen Riss in der Wasserleitung vor Eintritt eines Wasserschadens entdeckt und behoben werden. Vernetzte Haushaltsgeräte können also etwaigen Wartungsbedarf oder Fehlfunktionen selbst erkennen und melden. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit für technische Defekte, die eine häufige Ursache für Versicherungsfälle darstellen.
Das Smart Home ermöglicht es, Sicherungsobliegenheiten, die im Regelfall vom Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten zu erfüllen sind, ohne menschliches Zutun zu erfüllen. So sorgt zum Beispiel ein Smart Home Thermostat selbständig für eine perfekte Raumtemperatur. Es erfüllt damit die den Versicherungsnehmer treffende Obliegenheit zur Beheizung Kontrolle der Systeme in der kalten Jahreszeit. Ferner kann das Überwachungssystem die Obliegenheit zur Kontrolle nicht genutzter Gebäude oder Gebäudeteile selbständig übernehmen. Diese Obliegenheiten kann das Smart Home allerdings nur dann erfüllen, wenn es technisch dazu in der Lage ist. Es muss eine der menschlichen gleichwertige Kontrolle gewährleistet werden.
So vorteilhaft wie die Smart Home Technologie ist, ergeben sich daraus auch bisher komplett unbekannte Risiken. Dazu zählen mögliche Cyberangriffe und sonstige Gefahren im digitalen Umfeld. Diese können zum Versagen der an sich zuverlässigen Smart Home Einrichtung führen.
Eine Gefahrerhöhung (§ 23 VVG) ist eine nachträgliche Änderung der im Zeitpunkt der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers tatsächlich vorhandenen gefahrerheblichen Umstände. Diese Änderung macht den Eintritt eines Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens wahrscheinlicher.
Die Erhöhung der versicherten Gefahr kann den Versicherer nach § 26 VVG von seiner Leistungspflicht teilweise oder gänzlich befreien. Hinzukommt sein Recht aus § 25 VVG zur entsprechenden Prämienerhöhung, sowie zur Kündigung des Versicherungsvertrages nach § 24 VVG.
Allein die Installation von der Smart Home Technik reicht nicht aus, um eine Gefahrerhöhung zu bejahen. Mit der Installation für das versicherte Objekt gehen zwar gänzlich neue, nämlich digitale Risiken einher – etwa Angriffe unbefugter Dritte. Diese werden aber dadurch kompensiert, dass verwandte herkömmliche Risiken wegfallen. So kann zum Beispiel eine smarte Zutrittskontrolle gehackt werden, dafür entfällt aber das Risiko des physischen Schlüsselverlustes oder Abhandenkommens. Auch der geminderte Wartungsbedarf und die Selbsterkennung von Fehlfunktionen bieten einen angemessenen Ausgleich für die innewohnenden Risiken der Smart Home Installation an.
Im Gegensatz kann die unsachgemäße Installation von Smart Home Anlagen eine Gefahrerhöhung begründen. Hardware, Netz und Programme des Smart Home Systems müssen mit den jeweiligen am Markt verfügbaren Sicherungsmitteln geschützt sein. Einzelne Komponente können erst dann als ausreichend gesichert angesehen werden, wenn die Steuerung des Smart Home Systems über ein eigenständiges Netzwerk erfolgt. Der Zugang muss verschlüsselt, mit einem eigenen, den modernen Sicherheitsstandards entsprechenden Passwort geschützt, und vom gewöhnlichen Internetzugang getrennt sein.
Des Weiteren ist eine unsachgemäße Absicherung anzunehmen, wenn die zum Smart Home gehörende Hardware dem physischen Zugriff Unbefugter preisgegeben wird. Dies ist etwa der Fall, wenn die Verkabelung oder Geräte im Außenbereich für Unbefugte zugänglich sind.
Unterlässt es der Versicherungsnehmer, die Absicherung auf dem aktuellen Stand der Technik zu halten, tritt eine Gefahrerhöhung gem. § 23 Abs. 1 VVG ein. Grund dafür ist die fortlaufende Verstärkung der Gefahr für das versicherte Objekt: je mehr Zeit vergeht, umso weiter entwickelt sich das Instrumentarium für Cyberattacken. Dieser für digitale Gefahren charakteristische Zustand erfordert es, die unterbliebene Nachrüstung, etwa durch Nichtdurchführung von Softwareupdates, als subjektive Gefahrerhöhung einzustufen. Das Erfordernis einer ununterbrochenen Aktualisierung ist als Ausgleich dafür zu verstehen, dass der Versicherungsnehmer durch die Vernetzung ein dynamisches und ständig wachsendes Risiko in den Versicherungsverhältnis einbringt.
Die von der Rechtsprechung zur groben Fahrlässigkeit entwickelten Grundsätze gelten bei der Beurteilung von Schadensfällen mit digitalem Hintergrund entsprechend. Obwohl es zum sorglosen Umgang mit Passwörtern im Versicherungskontext keine Präzedenzfälle gibt, werden die zum Umgang mit physischen Einrichtungen geltenden § 81 VVG und § 276 BGB angewandt . Die Nichtänderung des Passworts in bestimmten zeitlichen Abschnitten, oder dessen achtlose Weitergabe an jeden beliebigen Dritten sind Verhaltensweisen, die unstreitig die Stufe der groben Fahrlässigkeit erreichen können. Im Gegensatz zu den Gefahren im Umgang mit physischen Sachen, sind Gefahrenquellen in der digitalen Welt für viele Versicherungsnehmer oftmals nicht so offenkundig. Mit der zunehmenden Digitalisierung des Alltags und dem steigenden Allgemeinwissen zur Anwendung neuer Technologien, werden aber strengere Anforderungen dem durchschnittlichen Versicherungsnehmer zu stellen sein, auf dessen Kenntnisse und Fähigkeiten es im Rahmen der Beurteilung grob fahrlässigen Verhaltens ankommt.
Die haushaltsübliche Digitalisierung im Rahmen der fortschreitenden technischen Entwicklung ist ein Risiko, das der Versicherer tragen muss. Daraus folgt aber für Versicherer die Frage nach einer künftig drohenden Existenzgefährdung. Wenn nämlich die Technologie so weit fortschreitet, dass Risiken minimiert, oder gar ausgeschlossen werden, würde damit auch das Bedürfnis nach einer Sachversicherung wegfallen. Wenngleich Smart Home Systeme noch nicht so ausgereift sind, um eine ernsthafte Bedarfsminderung auf dem Versicherungsmarkt bewirken zu können, ist es jetzt schon für Versicherer wichtig, die Vermarktung und Ausgestaltung ihrer Produkte der neuen Perspektive anzupassen. Dafür müssen Versicherer spezielle Versicherungstarife in Gebäude- und Hausratsversicherung schaffen, die auf einen Wohnraum mit „intelligenter“ Haustechnik abgestimmt sind.
Dabei sollen sämtliche Versicherungsnehmer mitgenommen werden. Es sind nicht nur die Bedürfnisse von denjenigen mit digitaler Affinität zu berücksichtigen, sondern auch von Versicherungsnehmern mit einem eher „analogen“ Lebensstil. So ist etwa bei der Schaffung einer Klausel, die den Versicherungsnehmer zur sorgfältigen Auswahl eines Zugangspassworts für das Smart Home System verpflichtet, gleichsam strenge Anforderungen zu stellen, ohne den Versicherungsnehmer zu überlasten.
Bei Hausratsversicherungen im Privatkundenbereich ist die Tendenz spürbar, Cybergefahren – wie Phishing, Pharming und ähnliche – in Versicherungspolicen mit einzubeziehen. Spezielle Cyberversicherungen haben sich im gewerblichen Bereich mittlerweile als Produkt etabliert, während für die Privatversicherung deren Angebot noch eher bescheiden ist.
Smart Home Systeme bieten Versicherern Potential zur Entwicklung neuer, spezieller Tarifmodelle und werfen zugleich vertragsrechtliche Fragen für bereits bestehende Versicherungsverhältnisse auf.
Ein mit der Hausvernetzung eng zusammenhängendes Thema ist die Anwendung und Versicherung moderner Schließsysteme (z.B. Haustüre, Garagentore und Fenster, die sich mit digitaler Technologie bedienen lassen). Diese gewinnen immer mehr an versicherungsrechtliche Relevanz, da sie den Zugang zu den versicherten Sachen ermöglichen und ein beachtliches Gefahrenpotential haben.
Sollten Sie als Versicherungsnehmer oder Versicherer Fragen zum Thema Versicherungsschutz des Smart Home Systems haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir helfen gerne bei der Beantwortung Ihrer Fragen.